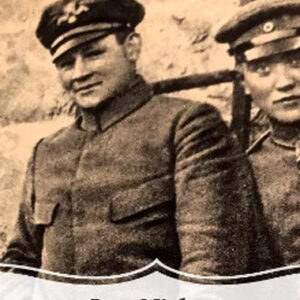„Die NS-Zwangsarbeit wurde lange bagatellisiert“
Eine Geschichte über Zwangsarbeit im Nazi-Deutschland gewinnt den Leipziger Buchpreis. Die Erinnerung an die Sklaven der Nazis wurde lange vernachlässigt. Man schätzt, dass über zwanzig Millionen Menschen aus allen besetzten Ländern während des Zweiten Weltkriegs für die Deutschen Sklavenarbeit leisten mussten. Ihre Arbeit war für das NS-System enorm wichtig Angesichts der Einberufung fast aller deutschen Männer zur Wehrmacht hielten nur die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter die deutsche Kriegswirtschaft aufrecht. Ohne sie wäre die landwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung ebenso zusammengebrochen wie die Rüstungsproduktion.
Großunternehmen wie auch kleine Handwerksbetriebe, Kommunen und Behörden, aber auch Bauern und private Haushalte forderten immer mehr ausländische Arbeitskräfte an und waren so mitverantwortlich für das System der Zwangsarbeit. Das reichte von Siemens, Daimler und über die Reichsbahn, die Stadtreinigung und die Krankenhäuser bis hin zum Bäcker, Bauern oder sogar Pfarrer.
Die ausländischen Arbeitskräfte wurden in überfüllten Baracken, Scheunen oder Gaststätten eingepfercht. In den Lager- und Betriebskantinen wurden sie nur äußerst unzureichend verpflegt. Ohne Lebensmittelmarken konnten sie von ihrem geringen Lohn nichts zu essen kaufen und litten ständig Hunger. Die wenigen verbleibenden Stunden Freizeit nutzten sie zunächst, um ihr Überleben zu sichern. Sie versuchten auf dem Schwarzmarkt Brot zu erstehen, oder sie gingen putzten – gegen ein Mittagessen – bei einer deutschen Familie. Damit konnten sich auch ärmere Deutsche ein Dienstmädchen oder einen Bauarbeiter ins Haus holen – wortwörtlich für ein Butterbrot.
Die Zwangsarbeit ist im Vergleich zu anderen Nazi-Verbrechen wie dem Holocaust weit weniger erforscht, weil in Deutschland die NS-Zwangsarbeit – trotz ihrer zentralen Rolle in den Nürnberger Prozessen – jahrzehntelang als übliche Begleiterscheinung von Krieg und Besatzungsherrschaft bezeichnet und damit zugleich bagatellisiert wurde. Sie wurde somit nicht als spezifisches NS-Unrecht anerkannt.
Erst 65 Jahre nach Kriegsende rief eine öffentliche Debatte um die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiter diese lange Zeit vergessenen Opfer wieder ins Gedächtnis. Überall in Deutschland erforschten lokale Initiativen die Geschichte der Zwangsarbeit und organisierten Begegnungen. Viele Gedenkstätten wurden errichtet. Dennoch ist das Bewusstsein für dieses Verbrechen bei vielen Deutschen besonders in konservativen und in rechtsnationalen Kreisen ohnehin noch immer gering.
Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes 1945 und ihrer Befreiung machten sich viele ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf eigene Faust sofort auf den Heimweg. Andere lebten als „Displaced Persons“ weiterhin in Lagern und warteten oft monatelang auf ihre Rückkehr in die Heimat oder auf eine Ausreise nach Übersee.

Am Standort HASAG, dem ehemals grössten Rüstungsbetrieb Sachsens, befindet sich eine Gedenkstätte für Zwangsarbeiterinnen / Keystone
Die meisten Betroffenen litten lange und besonders im Alter unter den psychischen und physischen Folgeschäden. In vielen osteuropäischen Ländern lebten sie nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaften am Rand des Existenzminimums. Jahrzehntelang verweigerten deutsche Regierungen und Unternehmen den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern eine Entschädigung. Erst Ende der 1990er-Jahre erzwang der politische Druck aus den USA die Gründung der von Staat und Wirtschaft finanzierten Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.
Die im Jahr 2000 gegründete Stiftung zahlte eine Gesamtsumme von rund 4,7 Mrd. Euro an 1,7 Mio. Überlebende aus. Die Betroffenen erhielten je nach Verfolgungsschicksal eine einmalige Zahlung zwischen 500 und 7.700 Euro. Kriegsgefangene und westeuropäische Zivilarbeiter waren grundsätzlich nicht leistungsberechtigt. Viel zu spät – erst 2015 – wurde schließlich den wenigen noch lebenden ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen eine symbolische Entschädigung zugesprochen. Diese Zahlungen sind nicht als Entschädigung und schon gar nicht als Wiedergutmachung zu werten. Wichtig sind sie aber als – freilich allzu späte – zumindest Geste der Anerkennung und Entschuldigung.
von
Günter Schwarz – 26.03.2017