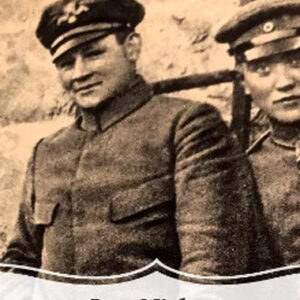Neuer Facebook-Skandal
Und darum geht es. – Wissenschaftler Aleksandr Kogan hat 2014 mit seiner Firma Global Science Research (GSR) mittels Umfrage-App bei Facebook Daten von Facebook-Nutzern und deren Freunden gesammelt. Dabei soll es sich um Daten von rund 50 Millionen Nutzern handeln. Facebook hatte ihm dies unter der Bedingung erlaubt, diese nur zu Forschungszwecken einzusetzen. Kogan soll sich nicht an die Abmachung gehalten haben und die Daten an das Unternehmen Cambridge Analytica weiter verkauft haben.
Als Facebook den Verstoß 2015 bemerkt hatte, wurden Kogan und Cambridge Analytica dazu aufgefordert, diese Daten zu löschen. Laut Whistleblower Christopher Wylie ist dieses nicht passiert. Wylie ist Ex-Mitarbeiter von Cambridge Analytica. Er sagte kürzlich der britischen Zeitung „Guardian“, dass die Daten sogar zur Entwicklung eines Tools eingesetzt wurden, mit dem man Facebook-User beeinflussen kann.
Das Unternehmen Cambridge Analytica ist spätestens seit dem Trump-Wahlkampf bekannt. Cambridge Analytica war für Trumps Wahlkampf in den Sozialen Medien verantwortlich. Und so arbeitet das Unternehmen. Es versucht mittels großer Datensätze Rückschlüsse auf die politische Einstellung zu ziehen. Inwiefern die gerade diskutierten Datensätze im Wahlkampf 2016 involviert waren, ist noch unklar.
Geschäftsführer von Cambridge Analytica ist Alexander Nix. Auch dieser ist in die Schlagzeilen geraten. Ein Reporter des britischen TV-Senders „Channel 4“ hat Nix mit versteckter Kamera dabei gefilmt, wie dieser von möglichen Erpressungsversuchen von Wahlkandidaten erzählt haben soll. Der Reporter wollte wissen, ob es Möglichkeiten gebe, negative Informationen über politische Kandidaten bei Wahlen in Sri Lanka zu beschaffen.
Facebook hat nach den Vorfällen sowohl Cambridge Analytica als auch Kogan von Facebook ausgesperrt, den Fall aber erst in den letzten Tagen publik gemacht – Jahre nach dem Datenmissbrauch und erst nach den öffentlichen Aussagen des Whistleblowers Christopher Wylie. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, nur auf öffentlichen Druck hin reagiert zu haben. Laut „New York Times“ wollte der Sicherheitschef von Facebook, Alex Stamos, die Vorfälle frühzeitig öffentlich machen. Das Unternehmen habe ihn jedoch zurückgepfiffen.
Damit steht das Unternehmen Facebook zum wiederholten Male im „Schadensbegrenzungsmodus“. Es liegt ein grundsätzliches Problem des Unternehmens darin, dass der Zugriff auf Daten eher breiter erlaubt sei, damit gute Ideen nicht von vorneherein eingeschränkt seien. Möglichkeiten würden intern Vorrang vor möglichen Gefahren und dem Missbrauch von Daten eingeräumt.
Der Eindruck ist, dass Facebook immer erst zurückrudert, wenn es in der Öffentlichkeit ein Problem gegeben hat. Das Unternehmen geht nie proaktiv gegen solche Probleme vor. Facebook hatte bereits im September einräumen müssen, dass in den Monaten vor und nach der US-Wahl etwa 3.000 Anzeigen mit polarisierenden Inhalten geschaltet worden seien. Die Auftraggeber säßen vermutlich in Russland.
Die Facebook-Aktie hat seit Bekanntwerden der Vorfälle ungefähr sieben Prozent an Wert eingebüßt. Am Montag sank der Börsenwert damit um rund 40 Milliarden Dollar. Auch politisch droht dem Unternehmen Ungemach. So hat die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Massachusetts Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Senatorin Amy Klobuchar möchte gar Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor den Justizausschuss des Senats in Washington zitieren. Großbritannien und die EU haben ebenfalls Ermittlungen angekündigt.
US-Senatorin fordert Zuckerberg-Anhörung

Günter Schwarz – 20.03.2018